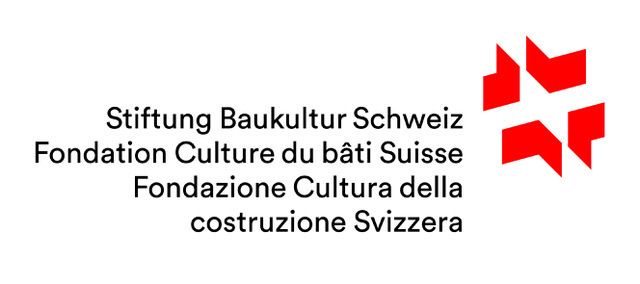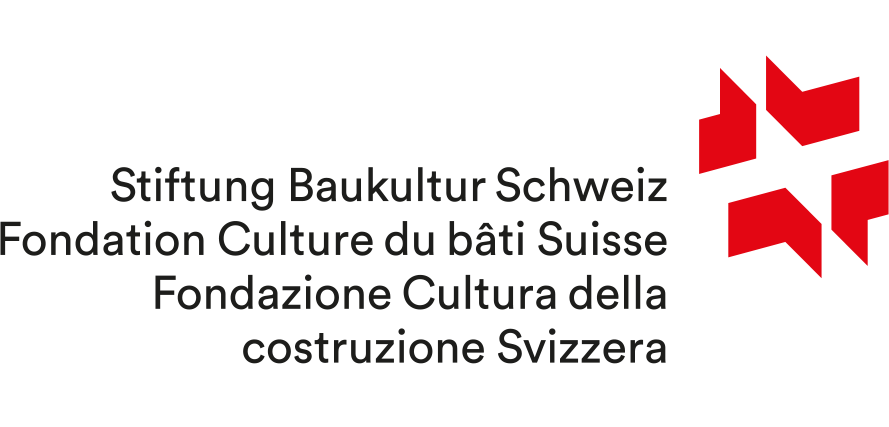Gabriela Theus, Geschäftsführerin der Immofonds Asset Management AG und Stiftungsrätin der Stiftung Baukultur Schweiz © Stiftung Baukultur Schweiz - Fotograf: Philippe Zürcher
13. Juni 2023
Stiftung Baukultur Schweiz | Baukultur persönlich
«Man findet in jeder Epoche hohe Baukultur»
Gabriela Theus ist zur Stiftungsrätin gewählt worden. Die Ökonomin ist Geschäftsführerin der Immofonds Asset Management AG und legt im Gespräch dar, wo Immobilienwirtschaft und Baukultur ihre Schnittstelle haben.
Sie sind seit 20 Jahren im Immobiliengeschäft tätig. Wie stellen wir uns ihre Tätigkeit genau vor?
Die Immofonds Asset Management AG ist von der FINMA als Fondsleitung bewilligt und reguliert. Seit 1955 investiert sie in schweizerische Immobilienwerte.
Die Immofonds Asset Management AG verwaltet zwei Produkte – den börsenkotierten IMMOFONDS und den IMMOFONDS suburban. Zum einen kümmern wir uns um das Asset Management, also die Verwaltung des Immobilienportfolios. Dafür, dass die Liegenschaften, die dem Fonds, den Anlegerinnen gehören, im Wert beständig sind und Ertrag generieren – und den Mieterinnen und Mietern attraktive Lebensräume bieten. Wir machen Portfolio- und Investitionsplanungen, wir führen Bewirtschaftungsfirmen, wir sorgen dafür, dass die Liegenschaften vermietet sind, wir kaufen oder verkaufen Liegenschaften für den Fonds oder geben Sanierungen in Auftrag. Wir haben als Fondsleitung den Auftrag, zum Schutz und im Sinne des Anlegers zu handeln.
Der zweite Teil unseres Tagesgeschäfts ist das Fondsmanagement: Da geht es um die Beziehungspflege zu den Anlegerinnen, aber auch um Reporting und regulatorische Themen. Die beiden Bereiche hängen natürlich zusammen, aber es sind unterschiedliche Personen im Team, die sich um die beiden Arbeitsfelder kümmern.
Was hat sich in den 20 Jahren in ihrem Beruf verändert?
Man kann eine starke Professionalisierung in der Branche feststellen. Ich war im weitesten Sinne immer auf Anlegerseite tätig und habe Investoren beraten. Damals, als ich begonnen habe, ist gerade die DCF-Methode als Bewertungsmethode für Renditeliegenschaften aufgekommen. Die Schätzermethode war aber noch weit verbreitet. Es gab keine spezifischen Ausbildungen auf Immobilien-Ökonomen-Seite. Die Angebote der HSLU oder von Curem, die wir heute kennen, waren erst am Entstehen.
Das Verständnis, dass eine Immobilie nicht nur Betongold ist, sondern auch als Ertragsobjekt zu begreifen und zu managen ist – das hat sich verändert.
Heute haben wir ganz andere Themen auf dem Radar als damals. Aktuell sind dies insbesondere Nachhaltigkeits- und Digitalisierungsthemen. Ausserdem sind neue Vermarktungs- und Vermietungstools entstanden – die Vermietung läuft über Plattformen, und manche sagen, bald im Metaverse, fast niemand platziert mehr eine Annonce in einer Zeitung.
Auch die Regulierung ist ein wichtiges Thema, bei dem sich viel verändert hat. Konkrete Herausforderungen bestehen beim Lärm, der Verdichtung, dem Wachstum und den sozialen Themen, die sich daraus ergeben und die wir miteinander lösen müssen: Die Privaten, die Institutionellen, die öffentliche Hand und die Gemeinnützigen. Wir alle müssen einen Beitrag leisten. Die Frage ist nicht, ob wir all diese Entwicklungen gut finden oder nicht, wir können sie schlicht nicht ignorieren und müssen nach Lösungen suchen. Und da kommt die Baukultur ins Spiel.
Inwiefern spielt Baukultur eine Rolle in Ihrem Betätigungsfeld?
Unser Anspruch ist es, Räume mit Charakter zu schaffen. Es ist wichtig, dass man der Einzigartigkeit einer Immobilie Rechnung trägt. Damit meine ich nicht eine «teure» Architektur, sondern eine wohl überlegte Gestaltung von Räumen. Dabei sind auch Aussenräume mitgemeint, ein enorm wichtiger Aspekt bei der Akzeptanz von Verdichtungen. Die Frage lautet: Wie kann ich einer Liegenschaft einen Mehrwert geben? Das sichert die langfristige Vermietbarkeit. Und ist ein Herausstellungsmerkmal.
Baukultur ist auch ein Thema bei Bestandsbauten. Dabei geht es darum, wie ich einem Gebäude mit Respekt begegnen kann. Seien das 200-jährige Gebäude oder solche aus den 1950er oder 1960er Jahren. Da erlebten wir auch einen Bauboom, die Grundrisse waren (häufig) gut und suffizient, die Statik vielleicht weniger, weil man auch sparsam mit den Ressourcen umgegangen ist. Wie und ob man auf dem Bestand aufbauen kann, ist dabei eine wichtige Frage. Natürlich ersetzen wir auch immer wieder, aber es gilt immer, sich die Frage zu stellen, welche Qualitäten vorhanden sind. Dabei müssen wir als Fondsleitung immer auch den Auftrag erfüllen, das Ertragspotenzial sicher zu stellen.
Was ist hohe Baukultur? Wie wird sie von Ihnen definiert?
Aus meiner Sicht geht es darum, wie ein Raum, ein Gebäude aber auch ein Stadtraum sich in die Umgebung einfügt. Es hat mit Beziehungen, Nachbarschaften und architektonischen Qualitäten zu tun, mit dem Ausdruck, der Haptik, einer Massstäblichkeit, Vor- und Rücksprüngen und dass man nicht nur den Innenraum, sondern auch den Aussenraum mitdenkt – und so findet man in jeder Epoche hohe Baukultur (und andererseits auch keine). Die Baukultur definiert sich aus einer individuellen Betrachtung, und hat nichts damit zu tun, ob mir persönlich eine Liegenschaft gefällt oder nicht.
Welchen ökonomischen Wert hat denn die hohe Baukultur in einer Zeit, in der in urbanen Zentren wie Zürich alles vermietbar ist, egal wie es aussieht?
Zuerst müssen wir uns fragen, wie lange die Situation, wie wir sie heute erleben, noch andauert. Dabei zeichnen sich Gebäude mit hoher Baukultur eher durch Kontinuität bei der Vermietbarkeit aus. Ob sie auch teurer vermietet werden können, kann ich nicht beurteilen. Auch bei der Durabilität, insbesondere im damit verbundenen (geringeren) Unterhalt sehe ich einen ökonomischen Beitrag der Baukultur.
Sie wurden zur Stiftungsrätin gewählt, ich gratuliere. Weshalb engagieren Sie sich in der Stiftung Baukultur Schweiz?
Als Akteure auf dem Markt müssen wir die Herausforderungen, die sich derzeit stellen, zusammen lösen. Deshalb engagieren wir uns als institutioneller Investor für die Branche. Es zeigt, dass wir bereit sind, unseren Beitrag zu leisten. Es geht mir auch darum, gegenseitiges Verständnis und Akzeptanz zu schaffen. Wir sind nicht grundsätzlich «die Bösen». Natürlich haben Behörden ihren Punkt, aber die privatwirtschaftliche Seite kann Themen auch angehen, ohne dass diese gleich in ein Gesetz gegossen werden müssen. Ich möchte die Rahmenbedingungen unserer Arbeit aktiv mitgestalten, damit wir auch in Zukunft langfristig unsere Wirtschaftsgrundlage erhalten können.
Was erschwert ihre Arbeit?
Wenn wir Baukultur schaffen, dann ist das mit Bewilligungsverfahren, Baugesuchen verknüpft. Diese Verfahren sind enorm lang, und es herrscht lange Rechtsunsicherheit – vielleicht sollten gewisse Einsprachemöglichkeiten eingeschränkt werden. Wenn nach einem partizipativen Verfahren entwickelt wurde oder Pläne unter Einbezug verschiedenster Stakeholder, Behörden und Fachstellen entstanden sind, und das Projekt dann trotzdem auf drei verschiedenen Ebenen angefochten werden kann, wird das Bauen teuer.
Was ist Ihre Einschätzung, wo stehen wir in 20 Jahren? Sollen und werden wir noch bauen?
Es ist eine Illusion, dass wir uns abschotten können in der Schweiz. Wir sind in einer offenen Volkswirtschaft, und wir werden weiterwachsen, die 10-Millionen-Schweiz wird kommen. Gleichzeitig werden Klimathemen eine viel grössere Relevanz haben. Die Digitalisierung wird Eingang in die Bauwirtschaft gefunden haben, damit wir einfacher und besser bauen können. Der Verkehr und die Art und Weise, wie wir uns bewegen, wird sich verändert haben hin zu gemeinschaftlichen Angeboten und öffentlichem Verkehr und Veloverkehr in den Städten.
Interviewerin: Jenny Keller, Stiftung Baukultur Schweiz
Stiftung Baukultur Schweiz
Die Stiftung Baukultur Schweiz ist eine nationale, neutrale und politisch unabhängige Stiftung. Im Frühjahr 2020 gegründet, bringt sie Akteure zusammen, schafft Plattformen, initiiert Prozesse und macht sich stark für jene, welche die Grundlagen der Baukultur inhaltlich ausarbeiten oder diese in der Praxis umsetzen.